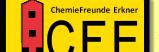



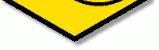
Chemie-Geschichte
Kunckel von Löwenstern, Johann
Kurzbiografie
Alchemist, Apotheker, Chemiker, Glasmacher
um 1630 (Hütten/Holstein) - 20.03.1703 (Stockholm?)
Wirkungsorte: Berlin, Dresden, Potsdam, Stockholm
Kunckel von Löwenstern kann als Begründer der Glastechnologie in Deutschland
angesehen werden. In seiner Potsdamer Schaffensperiode gelang es ihm
unter anderem das Verfahren der Rubinglasherstellung technisch umzusetzen.
1697 veröffentlichte er unter dem Titel "Ars Vitraria
Experimentalis Oder Die Vollkommene Glasmacherkunst" ein Buch, das
das erste seiner Art im deutschen Sprachraum war und bis ins 19. Jahrhundert
als Standardwerk galt.
Zu seinen Leistungen gehörte zudem die Einführung
von farbigem Zier- und Gebrauchsglas sowie die Entwicklung einer qualitativ
hochwertigen, leicht zu verarbeitenden Glasmasse.
Kunckel entstammte einer Glasmacherfamilie. Er bildete sich auf der Wanderschaft weiter und absolvierte eine Lehre als Apotheker. 1670-1676 leitete er das Kurfürstliche Laboratorium in Dresden.
Danach folgte er einem Ruf des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm nach Brandenburg.
1678 nahm Kunckel seine Arbeit zunächst in der Drewitzer
Glashütte und später auch in der von ihm eingerichteten Glasfabrik auf der Pfaueninsel
in Potsdam auf.
1693 berief ihn der schwedische König nach Stockholm. Er wirkte dort als Bergrat und wurde geadelt.
Quelle: Chemiker
von A-Z ...
Mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber:
Arbeitgerberverband Nordchemie e.V. und Verband der Chemischen Industrie
e.V., Landesverband Nordost
Biografische Notizen
- auch Kunkel von Löwenstern bzw. nur Kunckel/Kunkel
- deutscher Chemiker, Alchimist, Apotheker und Glasmacher
- (Wieder-)Erfinder des Rubinglases
- gilt als Begründer der Glastechnologie in Deutschland
- zwischen 1630 und 1638 (spätestens 1642) geboren in in Hütten bei Eckernförde (Schleswig-Holstein)
- stammt aus einer Glasmacherfamilie
- Ausbildung auf der Wanderschaft, Lehre als Apotheker
- in Norddeutschland, Sachsen, Brandenburg und Schweden als Glasmacher in verschiedenen Werkstätten, Glashütten und Laboratorien tätig
- in Wittenberg hielt er Vorlesungen über Chemie
- 1667 - Anstellung als "Geheimer Kammerdiener" des Kurfürsten Johann Georg II. von Sachsen
- 1670-1676 - er leitet das Kurfürstliche Laboratorium in Dresden (Venusbastei, in dem Böttger ca. vierzig Jahre später das erste europäische Porzellan herstellt)
- 1678 - K. folgt dem Ruf des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm (sog. Großer Kurfürst), arbeitet zunächst in Drewitzer Glashütte, dann in einer von ihm eingerichteten Glashütte auf der Pfaueninsel in Potsdam, gelang ihm die Herstellung von Kristallglas und
- 1679 - die Wiedererfindung von Rubinglas (sog. Kunckelgläser), vgl. dazu: L. Kuhnert: Das Goldrubinglas
- Verbindung Glasmacher Jobst Ludewig, der auf dem Hakendamm bei Potsdam eine Glashütte betrieb
- studiert eingehend die Literatur über die Glasmacherkunst und
- 1679 - K. veröffentlicht sein Buch "Ars Vitaria Experimentalis Oder Die Vollkommene Glasmacherkunst", das erste seiner Art im deutschen Sprachraum und lange Zeit Standardwerk (lt. Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann eine "Übersetzung und kritische Erörterung des 1612 erschienenen Werks 'L'Arte Vetraria distinta ...' des Italieners Antonio Neri)
- 1685 - Schenkung des ganzen Pfauenwerders bei Potsdam durch Kurfürst
- 1688 - nach Tod des Großen Kurfürsten in Ungnade gefallen (Betrug, Verschwendung)
- 1689 - Kunckels Glashütte auf der Pfaueninsel brennt ab, Schadenersatzforderungen an ihn
- 1693 - er verkauft sein Haus in Berlin (Klosterstraße, hier Bau der Parochialkirche)
- 1693 - der schwedische König beruft ihn nach Stockholm, wo er Bergrat und geadelt (von Löwenstein) wird
- 1693 - K. wird Mitglied der Academia Leopoldina
- 1699 - Mitglied der Académie Royal
- 1703 - Kunckel stirbt am 20. März (zum Todesort siehe unten)
- im Krongut Bornstedt (bei Potsdam) gibt es seit 2002 wieder eine Glashütte mit dem Namen "Kunckel"
Wo starb Kunckel?
Über den Todesort Kunckels existieren widersprüchliche Angaben:
- "Dreißighufen bei Pernau" in:
Meyers Konversationslexikon
ältere Wikipediaseiten, z.B. "Liste Wittenberger Persönlichkeiten" - "Dreißighufen bei Perna" in:
Chronik: Berlin - "Bernau bei Berlin auf Gut Dreißighufen" in:
Wikipedia zu Kunckel vom 01.10.2006 - "Dreißig-Hufen im Kreis Niederbarnim" in:
Encarta 2004 - "Dreißig-Hufen, das seit 1706 Neudörfchen heißt und im Kreis Niederbarnim liegt" in:
Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann - ganz anders in Chemiker A-Z und The Galileo Project:
"Stockholm"
Die ersten Angaben zum Todesort scheinen fehlerhaft, Perna oder Pernau
gibt es in Berlin-Brandenburg nicht, gemeint ist wahrscheinlich Bernau
(nördlich von Berlin).
Die Angaben Dreißig-Hufen/Neudörfchen im Kreis Niederbarnim sind
plausibel, dieser Ort liegt ca. 14 km nördlich von Bernau (nördlich Berlins).
Stockholm als Todesort würde mit Kunckels Wirken in Schweden
nach seinen Problemen in Brandenburg nach 1688 korrespondieren.
Lesen Sie weiter: |
|
| Biografische Notizen | |
| Wo starb Kunckel? | |
| Quellen + Literatur | |
| Interessante Links | |
| Chemie in Berlin und Brandenburg | |

Johann Kunckel
von Löwenstern
(um 1630-1703)
L. Kuhnert: "Johann Kunckel - Die Erfindung der Nanotechnologie in Berlin"
Am 19. Juni 2009 stellte uns unser Mitglied Dr. L. Kuhnert seine Kunckel-Biografie vor.
Dabei zeigte er auch einen nach Kunckel gefertigten Becher aus Goldrubinglas.

Titel der Kunckel-Biografie von L. Kuhnert
Weitere Informationen zu L. Kuhnerts Buch:
Interessante Links
Quellen (genutzt)
- Chemiker von A-Z ...
- Microsoft Encarta 2004
- Chronik: Berlin im Jahr 1703 auf luise-berlin.de
- Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann auf beyars.com
- Meyers Konversationslexikon von 1888
- The Galileo Project
Literatur (Auswahl)
- Bölsche, L.: Johann Kunckel. Der Glasmacher u. Alchymist des Großen Kurfürsten, Berlin 1909
- Dünnhaupt, Gerhard: Johann Kunckel (1630-1703), in: Personalbibliographien zu den Drucken des Barock, Bd. 4. Stuttgart: Hiersemann 1991, S. 2470-78
- Fetzer, W.: Johann Kunckel Leben u. Werk eines großen dt. Glasmachers des 17. Jh., Berlin 1977
- Fuchs, L.: Johann Kunckels Erfindung des Goldrubins, in: Kunstwanderer, Dezemberh., Jg. 1928/29
- Ganzenmüller, W.: Beitr. zur Gesch. des Goldrubinglases, Tl. 1, in: Glastechn. Ber., 15. Jg., H. 9-11, Frankfurt/M. 1937
- Ganzenmüller, W.: Johann Kunckel ein Glasmacher u. -forscher zur Barockzeit, in: Glastechn. Ber., 19. Jg., H. 10, Frankfurt/M. 1941
- Kuhnert, Lothar: Johann Kunckel - Die Erfindung der Nanotechnologie in Berlin, Berlin 2008
- Maurach, H.: Johann Kunckel 1630-1703, in: Deutsches Museum Abhandlungen und Berichte, 5, Nr. 2 (1933), 31-64
- Mylius, W.: Johann Kunckel, in: Keram. Rundschau, Nr. 3, Berlin 1927
- Peters, Hermann: Kunckels Verdienste um die Chemie, in: Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, 4 (1912), 178-214
- Rau, G.: Das Glaslaboratorium des Johann Kunckel auf der Pfaueninsel, in: Ausgrabungen in Berlin 3, 1973
- Schulze: Chem. Untersuchungen an Fundstücken aus dem Glaslaboratorium des Johann Kunckel, in: Ausgrabungen in Berlin 3, 1973
- Schulze, Gerhard: Kunckels Glaslaboratorium, in: Med.-hist. Journal 11 1976), 149-156
- Spiegl, W.: Johann Kunckel und die Erfindung des Goldrubins, in: Weltkunst, H. 19, 1988
- Troitzch, Ulrich: Neue deutsche Biographie 13, 287a-98b
Interessante Links
- Kunckel Biografie auf der Website von Dr. sc. Lothar Kuhnert - Laboratorium
- L. Kuhnert: Das Goldrubinglas
- Die Geschichte von Kunckel auf der Pfaueninsel
© ChemieFreunde
Erkner e. V.
Diese Seite wurde erstellt am 24.09.2006

